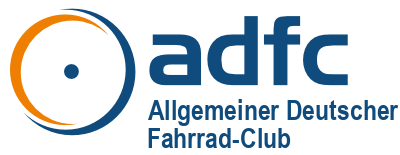Das Rücklicht Garmin Varia RCT715 mit integrierter Kamera zeichnet permanent auf und speichert Daten aber nur bei einem erkannten Unfall. © Hersteller Garmin
Unfallvideos als Beweismittel: Was erlaubt das Gesetz?
Unfallvideos können vor Gericht als Beweismittel dienen. Das Grundsatzurteil lässt sich auf Dashcams am Fahrradlenker oder -helm übertragen. Wie wägt das Gericht dabei Datenschutz gegen Beweisinteressen ab?
Der Bundesgerichtshof (BGH) stellte am 15. Mai 2018 (Az. VI ZR 233/17) in seinem Grundsatzurteil klar, dass Aufnahmen aus dem öffentlichen Straßenraum trotz Datenschutzverstößen als Beweismittel zulässig sein können. ADFC-Rechtsexperte Roland Huhn sagt: „Das deutsche Prozessrecht verbietet nicht automatisch unerlaubt gewonnene Beweise. Gerichte müssen immer abwägen.“
Gerichtliche Interessenabwägung
Der Bundesgerichtshof entschied, dass Aufnahmen aus öffentlichen Straßenräumen trotz Datenschutzbedenken verwertbar sind, denn alle Verkehrsteilnehmenden bringen durch ihre Anwesenheit im öffentlichen Raum eine Grundakzeptanz für Beobachtungen mit.
Dabei unterscheidet das Gericht zwei Situationen:
- Beweissicherung nach einem selbst erlebten Unfall (auch wenn die Kamera bereits vor der Kollision lief)
- Dokumentation von Ordnungswidrigkeiten anderer Verkehrsteilnehmenden mit Anzeigenabsicht
Das BGH-Urteil bezieht sich hauptsächlich auf die erste Situation und erkennt hier ein legitimes Interesse an.
Ausschlaggebend sind folgende Kriterien:
- Die Aufnahme zeigt ein konkretes Ereignis mit direktem Bezug zum Rechtsstreit.
- Das Gericht prüft im Einzelfall, ob das Interesse an der Beweisführung wichtiger ist als der Datenschutz der gefilmten Personen.
- Gefilmte Personen halten sich in Bereichen auf, die allgemein einsehbar sind.
Passiv aufgezeichnetes Material, das ohne gezielte Überwachung entsteht, bewerteten die Richter als weniger problematisch. Systeme mit automatischer Löschung nach wenigen Minuten gelten als datenschutzkonform.
Pflichten nach einem Unfall
Das Strafgesetzbuch (§ 142) und die Straßenverkehrs-Ordnung (§ 34) verpflichten Beteiligte, nach einem Unfall persönliche Daten anzugeben. Dazu zählen Name, Anschrift, Art der Beteiligung sowie die Vorlage von Führerschein und Versicherungsnachweis. Verstöße dagegen können als Fahrerflucht gewertet werden.
Praxisbeispiele zeigen, dass viele Unfallhergänge ohne Videoaufnahmen nicht zweifelsfrei rekonstruierbar sind. Besonders bei Kollisionen mit abbiegenden Kraftfahrzeugen oder Dooring-Unfällen können Kameras entscheidende Beweise liefern.
Rechte unbeteiligter Dritter
Das Urteil schützt ausdrücklich Personen, die zufällig in Aufnahmen geraten. Die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) sieht für rechtswidrige Aufnahmen hohe Bußgelder vor.
Der ADFC-Rechtsexperte Roland Huhn warnt vor dauerhaften Aufzeichnungen ohne konkreten Anlass. Wer lediglich allgemeine Verkehrsüberwachung betreibt, handelt rechtswidrig. Erlaubt bleibt das Filmen zur unmittelbaren Beweissicherung nach einem Vorfall.
Regeln fürs Filmen
Beim Verkehrsgerichtstag 2016 in Goslar wurden klare Empfehlungen ausgesprochen:
- Fortlaufendes Überschreiben der Aufnahme nach wenigen Minuten
- Dauerhafte Speicherung erst bei Unfallauslösung
Veröffentlichung von Aufnahmen
Bei der Veröffentlichung von Aufnahmen gilt:
- Videos, in denen einzelne Personen erkennbar sind (durch Gesicht oder Autokennzeichen, die zu den Haltern bzw. Halterinnen zurückverfolgt werden können), dürfen nicht in sozialen Medien oder auf Plattformen veröffentlicht werden.
- Nur in Ausnahmefällen, wenn ein berechtigtes Interesse besteht (z. B. für Bildungszwecke oder Verkehrsicherheitsanalysen), können vollständig anonymisierte Aufnahmen verwendet werden.
- Wer Dashcam-Videos veröffentlichen will, muss Gesichter und Kennzeichen vollständig verpixeln, sodass keine Identifizierung möglich ist.
- Nicht-anonymisierte Unfallvideos sollten ausschließlich an Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichte übermittelt werden.
Der ADFC-Rechtsexperte Roland Huhn rät, Aufnahmen nach Abschluss des Verfahrens umgehend zu löschen. Manipulationen am Material – etwa durch Schnitte oder nachträgliche Bearbeitung – können zum Beweisverlust führen.
Fazit
Das BGH-Urteil schafft einen praktikablen Rahmen: Verantwortungsvoll genutzte Kameras stärken die Rechte Unfallgeschädigter, ohne Grundrechte Dritter auszuhebeln. Technische Lösungen und klare gesetzliche Vorgaben minimieren dabei Datenschutzrisiken.
Autor: Moritz Kennedy
Werde ADFC-Mitglied!
Unterstütze den ADFC und die Rad-Lobby, werde Mitglied und nutze exklusive Vorteile!
- exklusive deutschlandweite Pannenhilfe
- exklusives Mitgliedermagazin als E-Paper
- Rechtsschutzversicherung
- Vorteile bei vielen Kooperationspartnern
- und vieles mehr
Dein Mitgliedsbeitrag macht den ADFC stark!